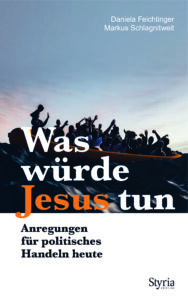3. Fastensonntag – C: Lk 13,1-9
(Linz − Ursulinenkirche, 23. III. 2025)
Nehmen wir einmal an, die Worte Jesu wären wirklich so gefallen, wie das Lk-Evangelium sie uns überliefert! Dann stellt sich doch die Frage nach ihrem logischen Zusammenhang, also nach dem berühmten roten Faden, der sie zusammenhält; denn ganz so einfach erschließt sich der bei genauem Hinhören nicht: Da geht es zuerst bei den beiden Unglücksfällen, die da erwähnt werden und bei denen jeweils Menschen ums Leben kamen, um eine Denkfigur, die nicht nur im Judentum zur Zeit Jesu gang und gäbe gewesen sein dürfte, sondern auch heute noch verbreitet ist: Wenn jemandem ein Unglück zustößt, so wurde das damals als direkte Folge bzw. „Strafe“ für begangene Sünden des Unglücksraben gedeutet. Heute reden wir weniger von „Sünde“ und „Strafgericht“, aber wir suchen immer noch nach kausalen Begründungen für ein Unglück: Wodurch wurde es ausgelöst? Wer hat Schuld daran? Wer ist dafür verantwortlich? – Und sobald diese Fragen beantwortet sind, scheint es allen gleich besser zu gehen: Das Unglück ist eingeordnet. Man kennt sich aus. Und solange man nicht selbst unmittelbar betroffen ist, kann das Leben wieder weitergehen. Jesus enttarnt dieses praktische Sich-aus-der-Affäre-Ziehen einerseits und warnt: „Vorsicht! Ihr seid um nichts besser – solange Ihr nicht umkehrt und Euer Leben ändert.“ Andererseits bleibt er damit zunächst selbst ganz der skizzierten Denkfigur verhaftet: Die Strafe folgt der Sünde auf den Fuß wie die Sühne der Schuld. Kehrt also um!
Dann dieses Gleichnis mit dem Feigenbaum. Zunächst scheint der Zusammenhang klar: Der Baum ist wie ein Sünder; er tut nicht, was er soll: Früchte tragen. Also soll er umgehauen werden. Strafe muss sein! Selber schuld! – Aber dann bleibt offen, ob genau das wirklich geschieht. Der schlechte Baum hat plötzlich einen Verteidiger: Er soll noch eine Chance bekommen und sogar Unterstützung, diese Chance auch zu nutzen. Hier wird die direkte Verbindung zwischen Schuld und Sühne, zwischen Vergehen und Strafe plötzlich aufgebrochen – zumindest unter der Bedingung der Umkehr: Dem Sünder, der umkehrt und sein Leben zum Guten wendet, wird seine Schuld offenbar nicht länger angerechnet.
Das ist eine ganz andere Denkfigur. Hier wird plötzlich deutlich, was menschliche Beziehungen und ihre Freiheit ausmacht – im Unterschied zu den unbarmherzigen Kausalketten der Naturgesetze: Wir sind zwar Teil der Natur mit ihren unverrückbaren Gesetzmäßigkeiten und ihr doch nicht einfach unterworfen. Auch der strikte Automatismus, wonach die Strafe der Sünde direkt auf den Fuß folgt, wird dem nicht gerecht. Menschen sind frei und deshalb zu Entwicklung fähig – zum Schlechten ebenso wie zum Guten. Und deshalb verdienen sie immer wieder eine neue Chance – wie der Feigenbaum. Kein Mensch verdient es, irgendwann abgeschrieben und aufgegeben zu werden. Jedem Menschen muss man – bis zuletzt – das Gute zutrauen und ihn dazu ermutigen und unterstützen.
Das ist jetzt kein moralischer Freibrief im Sinne eines billigen Laissez-faire; es ist vielmehr ein Freibrief zum Guten. Es ist Zeit des Lebens nie zu spät, diesen zu nutzen und das eigene Leben auf einen neuen, besseren Weg zu setzen. Nur: Irgendwann muss man schon damit anfangen. Denn der Freibrief zum Guten kennt schon ein Ablaufdatum; es ist dasselbe wie das Ablaufdatum unseres Lebens.